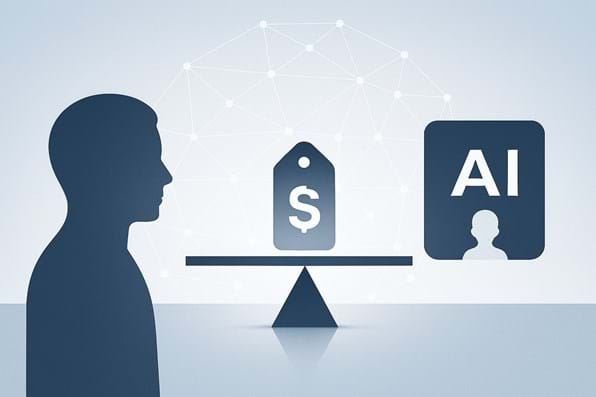Wenn KI-Agenten beginnen, die Software zu nutzen, zählt nicht mehr die Anzahl der User, sondern das Ergebnis. Das verändert die ökonomische Logik von SaaS grundlegend, sowohl für IT-Anbieter als auch für die Kunden.
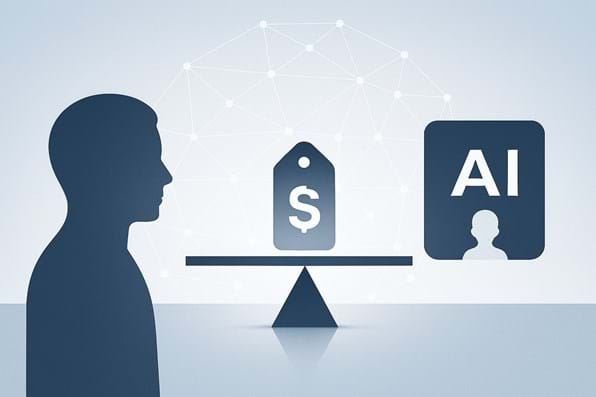
Vom Nutzer zur Wirkung: KI-Agenten verändern die Spielregeln. (Symbolbild Copilot)
In den letzten zwei Jahrzehnten beruhte das Geschäftsmodell von Software-as-a-Service weitgehend auf nur einem Preismodell: der Abrechnung pro Nutzer oder «per seat». Das funktioniert gut, solange Software hauptsächlich von Menschen benutzt wird. Doch durch den Aufstieg agentischer KI-Systeme verliert das Argument «mehr Nutzer gleich mehr Wert» erheblich an Schlagkraft.
KI-Agenten ersetzen zunehmend menschliche Interaktion mit der Software. Wir treten ein in das Zeitalter von Agentic SaaS (ASaaS). Dabei geht es nicht mehr um Nutzung, sondern um Zielerreichung und Ergebnisse. Die ökonomische Logik erfordert daher eine Neuausrichtung der Preisgestaltung und des Wertversprechens. Aber nicht nur die Benutzerrolle verändert sich grundlegend.
Warum das nutzerbasierte Modell nicht mehr funktioniert
Der sich abzeichnende Abschied vom Pro-Nutzer-Modell hat zwei wesentliche Gründe:
Menschen sind nicht mehr die Hauptakteure
Im ASaaS-Modell werden Menschen von aktiven Nutzern zu «passiven» Zielvorgebern. Statt in einem ERP-System Buttons zu klicken oder Daten einzugeben, formulieren sie in natürlicher Sprache (conversational AI) die Ziele. So kann z. B. eine Eingabe lauten: «Erstelle eine Cash-Flow Projektion für das nächste Quartal unter Berücksichtigung der letzten zwei Jahre und der geplanten Ausgaben für den Launch unseres neuen Produktes». Die KI-Agenten übernehmen die Interaktion mit der Software und den verfügbaren Datenquellen. Der Kunde dürfte somit kaum noch bereit sein, den gleichen Preis wie für die Zugangsberechtigung von z. B. bisher 100 SaaS-Nutzern zu zahlen, wenn drei Agenten deren Job erledigen. Obwohl der ASaaS-Anbieter ihm einen enormen Effizienzgewinn und eine deutliche bessere User Experience liefert.
Die Kostenstruktur ist eine andere
Agenten arbeiten rund um die Uhr, ohne Ermüdung, weltweit gleichzeitig, zukünftig wahrscheinlich auch herstellerunabhängig vernetzt und skalieren in Sekunden. Diesen Prozessen liegt eine andere Kostenstruktur zugrunde: laufende Trainingskosten und die Anpassung von Modellen sowie GPU/TPU-Zeit, hoher Energieverbrauch durch die ständige Verarbeitung grosser Datenmengen, skalierbare Cloud-Ressourcen etc. Laut OpenAI kostet GPT4 Turbo 0,01 bis 0,03 US-Dollar pro 1000 Tokens (sog. Inference Cost, Stand Juli 2025). Beim Einsatz mehrerer Agenten, etwa in Verbindung mit solchen, die auf bestimmte Aufgaben spezialisiert sind, können sich diese Kosten sehr schnell aufschaukeln. KI-Systeme sind daher kostenintensiver in Betrieb und Wartung als statische SaaS-Lösungen. Das User-Modell bildet diese Kostenstruktur nicht ab und kann für ASaaS-Hersteller grosse finanzielle Risiken bergen.
Neue Preismodelle für Agentic SaaS
Vor diesem Hintergrund experimentieren Anbieter mit neuen Preisansätzen, die besser zu ASaaS passen. Der Begriff «experimentieren» ist hier bewusst gewählt, da Vieles noch in der Findung ist.
Ergebnisbasierte Preisgestaltung (Value-as-a-Service):
Die Preise orientieren sich an konkreten Ergebnissen – etwa pro erstelltes Dokument, pro qualifiziertes Lead oder als Prozentsatz erzielter Einsparungen. Auch eine Umsatzbeteiligung ist in manchen Bereichen denkbar. Der Software-Provider erhält einen Anteil am generierten Mehrwert. Besonders attraktiv ist dies in performance-orientierten Branchen wie E-Commerce oder Marketing mit klarem ROI.
Beispiele:
- Kundensupport: Preis pro gelöstes Ticket oder Gespräch.
- Marketing: Preis basierend auf der Conversion Rate oder Lead-Generierung.
- Produktivitätstools: Preis gemessen an eingesparten Stunden.
Dieses Modell bringt Preis und Wert besser in Einklang, erhöht aber deutlich die Komplexität in der Ergebnisdefinition, der Attribution und des Trackings. Varianten des Value-as-a-Service Preismodells finden sich u.a. bei Salesforce, ZenDesk, Intercom (Kundendienst) oder ChargeFlow (eCommerce).
Daneben existieren unterschiedliche Verbrauchsmodelle:
Agenten-Lizenzen
Statt für jeden menschlichen Nutzer eine Lizenz zu kaufen, zahlen Kunden hier für die Anzahl der KI-Agenten, die gleichzeitig oder parallel aktiv sein können.
Beispiel:
Ein solches Preismodell findet sich bei Genesys, einem Anbieter von Call Center und Customer Experience Lösungen. Das Unternehmen bietet neben anderen Preismodellen dem Kunden «Concurrent Bots» an. Je mehr parallele Konversationen ein Unternehmen über Bots führen möchte, desto mehr Kapazität (sprich: Lizenzen für virtuelle Agenten) muss es erwerben.
Task Credits
Der Kunde zahlt für die von den Agenten erfolgreich erledigten Aufgaben.
Beispiel:
OpenAI bietet über seine API verschiedene KI-Modelle an – darunter GPT-5 und spezialisierte Varianten wie GPT-5 mini und nano. Auch Bildgenerierung mit DALL·E ist weiterhin möglich. Die Abrechnung erfolgt typischerweise nach verbrauchten Tokens oder erledigten Aufgaben. Kunden zahlen für jede erledigte Aufgabe (z. B. Text generieren, Bild erstellen, Sprache transkribieren), was dem Modell der Task Credits entspricht.
Hybride Modelle
Sie bestehen aus einer Mischung aus Grundgebühr und nutzungsbasierten Komponenten. Das kann etwa ein Basistarif für den Zugang sein, kombiniert mit verbrauchsabhängigen Kosten für höherwertige, KI-gestützte Funktionen. Zusätzliche Leistungen rechtfertigen in diesen Fällen einen Premiumpreis. Ziel ist es, ein Gleichgewicht zwischen planbarem Umsatz für Anbieter und wertbasierten Kosten für Kunden zu finden.
Beispiel:
SAP SuccessFactors bietet zusätzlich zu seinen HR Basisfunktionen KI-Komponenten, die mehr Rechenleistung oder spezielle Datenverarbeitung erfordern und daher kostenpflichtig sind. Das sind etwa tiefgehende prädiktive Analysen für Personalfluktuation oder hochautomatisierte Bewerber-Screenings durch Bots.
Konsequenzen für Softwareanbieter und Endkunden
Die Integration von KI in SaaS-Anwendungen bedeutet nicht nur eine Funktionsergänzung, sondern eine tiefgreifende Veränderung von Geschäftsmodellen, die sowohl Kunden wie ISVs betrifft. Messbare Wertschöpfung statt blosser Nutzung ist ihre Grundlage.
Das impliziert zum einen, dass sowohl Anbieter wie auch Kunden in der Lage sind, Ergebnisse zweifelsfrei nachzuvollziehen, zu quantifizieren und der Software zuzuschreiben (Attributionsfähigkeit). Produktdesign und Analytics müssen auf diese neuen Metriken ausgerichtet werden. Niemand möchte sich mit seinem Kunden bzw. Lieferanten um jede Rechnung streiten, weil im Lizenzvertrag die Definition von «Erfolg» unklar ist oder Ergebnisse nicht messbar sind.
Empfehlenswert ist es, bei der Festlegung dem «KISS-Prinzip» zu folgen: Keep it simple, stupid». Zum anderen kann sich dadurch das Geschäftsrisiko deutlich in Richtung Anbieter verschieben, während fehlende Wertschöpfung bei «per user»-Modellen zumindest kurzfristig eher das Problem des Kunden ist.
Softwareanbieter müssen sich also tiefer mit den Geschäftsprozessen ihrer Kunden auseinandersetzen und robuste Analysefähigkeiten im Hinblick auf Ergebnisse entwickeln. Dadurch werden sie zum Partner des Kunden und direkter Teilhaber an dessen Geschäftsrisiko.
Der Autor
Dr. Jürgen Müller ist Partner bei
Go Europe Consulting und hat mehr als 35 Jahre in verantwortungsvollen Positionen in der IT in Europa und den USA gearbeitet.
LinkedIn
Agentic AI – Wenn Software Ihr Business neu erfindet
Wie verändern KI-Agenten schon jetzt Geschäftsprozesse?
Im Webinar mit dem Autor sowie Experten von Google Cloud und Relanto erfahren Sie es – praxisnah und konkret.
Sie können:
Der Beitrag erschien im topsoft Fachmagazin 25-3
Das Schweizer Fachmagazin für Digitales Business kostenlos abonnieren
Abonnieren Sie das topsoft Fachmagazin kostenlos. 4 x im Jahr in Ihrem Briefkasten.